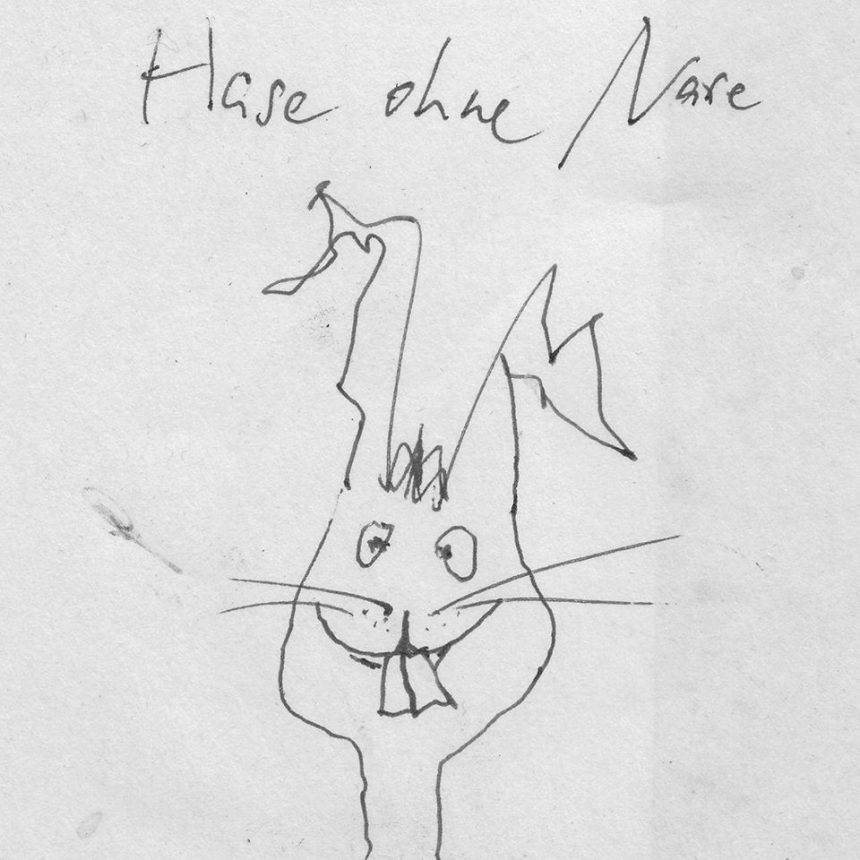„Ostdeutsch, migrantisch, queer: Der neue Berliner Senat ist so divers, wie manch linke Regierung es gern wäre“, frohlockte unlängst Der Tagesspiegel, anlässlich der Vorstellung der künftigen Senatsmitglieder der neuen schwarz-roten Regierungskoalition in Berlin: „Drei Menschen mit Migrationsgeschichte, vier ostdeutsche Frauen, ein offen schwul lebender Mann: CDU und SPD repräsentieren die Gesellschaft wie selten.“ Auch Die Zeit zeigte sich positiv überrascht: „Das künftige Regierungspersonal ist so divers, wie man es von dem in den vergangenen Jahren immer leicht verstaubt daherkommenden CDU-Landesverband spontan nicht erwartet hätte.“ Und in der Taz hätte man dem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner offenbar am liebsten gleich den Lehnseid geschworen: „Man kann von der Berliner GroKo halten, was man will. Immerhin ist sie divers. Berlin ist vielleicht nicht mehr so sexy wie einst, aber dafür modern. (…) Herzlichen Glückwunsch, Berlin – und willkommen in der Realität.“
So laut tobte der mediale Freudentaumel, dass sich sogar der gerade erst zur großen Überraschung der deutschen Öffentlichkeit als Sammelbecken für moralisch entgrenzte, misogyne Reaktionäre entlarvte Springer Verlag kurz aus seinem Büßereckchen traute und Wegners Personalentscheidung via Die Welt als „Truppe, die zu Berlin passt und eben nicht ‚reaktionär‘ ist, wie viele GroKo-Gegner es glauben machen wollten“ lobte.
„Na jut, wird doch nich allet so schlimm“, mögen sich viele Berlinerinnen und Berliner angesichts solcher Artikel nun vielleicht denken. Doch leider muss an dieser Stelle daran erinnert werden, dass Heiner Müllers ewig gültiges Diktum, dass zehn Deutsche natürlich dümmer als fünf seien, auch für Journalisten zutrifft. Wobei allerdings manches, was dumm klingt, in Wahrheit einer klaren Agenda folgt. Im bürgerlich-wirtschaftsliberalen Tagesspiegel etwa hat man zwar seit längerer Zeit eine eigene Rubrik für queere Themen und erlaubt seinen Autoren nach Belieben zu gendern, zu einer linken Zeitung wird er deshalb aber ebenso wenig, wie ein DAX-Konzern zur anarchistischen Landkommune mutiert, wenn er Stellenausschreibungen mit dem Zusatz „(w/m/d)“ garniert.
Diversität an sich ist eben nicht per se links, sondern in erster Linie einer sich verändernden gesellschaftlichen Realität geschuldet oder aus der Perspektive konservativer Parteistrategen schlicht (hier stimmt die Wortwahl der Taz): modern. Eine Regierung kann halbwegs vernünftige Politik für die ganze Vielfalt der Gesellschaft machen ohne diese gleichzeitig personell abzubilden. Umgekehrt aber kann es einer divers zusammengesetzten Regierung, das zeigt der breite mediale Rückenwind für den neuen Senat, deutlich leichter fallen, reaktionäre Politik umzusetzen. Das ist der Weg des Kai Wegner und seiner sozialdemokratischen Steigbügelhalterin Franziska Giffey.
Vergisst man nämlich mal Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und Herkünfte der Senatsmitglieder, zeigt sich ein ganz anderes Bild: Wegner selbst wurde noch vor zwei Jahren von Parteifreund Mario Czaja (inzwischen CDU-Generalsekretär im Bund) attestiert, er sei „dichter an den Positionen von Hans-Georg Maaßen als an denen von Angela Merkel“, und auch Giffey hat in ihrer Verweigerungshaltung gegen den erfolgreichen Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbaubestände ein eher restriktives Demokratieverständnis offenbart. Die von ihr gewünschte Verhinderung der Umsetzung obliegt nun allerdings ihrem Parteifreund Christian Gaebler als neuem Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Zudem wird es seine Aufgabe sein, auch den anderen so erfolgreichen wie unbequemen Volksentscheid, nämlich den zur Nicht-Bebauung des Tempelhofer Felds, vom Tisch zu räumen, um doch noch eine möglichst breite „Randbebauung“ durchzusetzen. Und weil Berlin bekanntlich keinen günstigen Wohnraum braucht, soll er auch den Verkauf von landeseigenen Grundstücken wieder ermöglichen.
Mag sein, dass aus Wegners Perspektive die Chef-Lobbyistin des Berliner-Brandenburger Baugewerbes Manja Schreiner (CDU) eine noch bessere Wahl für das Stadtentwicklungsressort gewesen wäre, aber das hätte wohl deutlich mehr Unmut in der Stadtpresse provoziert. Schreiner wird stattdessen nun als Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt auf andere Weise den Weg frei machen – nicht nur für Autos. Mit vereinfachter Neubebauung von Freiflächen und Abschaffung von verpflichtendem Ökogedöns wie etwa Dachbegrünungen (beides hatte sie bereits als Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg gefordert) wird auch sie ihren Beitrag zum Investorenglück leisten, wann immer ihr die Verlängerung der Stadtautobahn A100 durch ein Gebiet, das aktuell noch Heimat diverser Clubs und alternativer Kulturbühnen ist, Zeit dafür lässt.
Im Innenressort darf Sozialdemokratin Iris Spanger endlich von der rot-grün-roten Leine, die sie bislang daran hinderte ihre eher rechtskonservativ geprägten Law and Order-Ideen umzusetzen – ein doppelter Gewinn für Wegner, weil die zu erwartenden Kollateralschäden dieser Politik am Ende nicht an ihm, sondern an der SPD hängen bleiben.
Als ebenso geschickt erwies er sich bei der Besetzung der Ressorts Justiz und Verbraucherschutz sowie Kultur, Zusammenhalt, Engagement- und Demokratieförderung. Hier tünchen die im Iran geborene Felor Badenberg und Joe Chialo, Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie, den neuen Senat „bunt“ (um hier auch mal diesen ebenso beliebten wie dämlichen Begriff für das nicht eben breit angelegte Farbspektrum menschlicher Pigmentierung zu verwenden). Badenberg war zuvor Vizepräsidentin des bekanntlich nicht sonderlich links tickenden Bundesamtes für Verfassungsschutz, dort aber immerhin zuletzt Leiterin der Abteilung Rechtsextremismus. Damit soll wohl Wegners mutmaßliche inhaltliche Nähe zum offen rechtsradikal tönenden früheren Chef des Dienstes Hans-Georg Maaßen zumindest konterkariert werden.
Joe Chialo hingegen, als Musikmanager vorwiegend im Bereich Schlager aktiv, verfügt über ein aus CDU-Sicht erfreulich marktorientiertes Kunstverständnis und – noch erfreulicher – keinerlei nachweisbare Verflechtung mit der renitenten Berliner Kulturszene. Um seine Unbelecktheit in Sachen „Hochkultur“ zu kaschieren, steht ihm Sarah Wedl-Wilson, zuvor Rektorin der Hochschule für Musik Hanns Eisler, als Staatssekretärin zur Seite. Die freie Szene der Stadt aber bekommt keinen Fürsprecher und wird sich wohl künftig um die vom reich gedeckten Tisch der „Kreativwirtschaft“ rieselnden Brosamen balgen müssen.
Gleich dreifach zahlt Cansel Kiziltepe (SPD) aufs Diversitätskonto des neuen Senats ein. Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung ist nicht nur weiblich und Kind sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei, sie gehört in ihrer Partei auch eher zum linken Flügel. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, den konservativen Rollback des neuen Senats mit ein bisschen altvertrauter sozialdemokratischer Lyrik zu begleiten – irgendwas mit mehr Lohn für weniger Arbeit oder so. Ob es indes eine gute Idee war, ausgerechnet die den meisten Berlinern ohnehin eher arbeitsunwillig erscheinende Verwaltung für ein Modellprojekt zur Vier-Tage-Woche ins Spiel zu bringen, darf bezweifelt werden.
Welche Akzente Ina Czyborra (SPD) im Ressort Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Katharina Günther-Wünsch (CDU) im Ressort Bildung, Jugend, Familie sowie Stefan Evers (CDU), der neue Finanzsenator und rechte Hand des Regierenden, setzen werden, bleibt abzuwarten. Aber in Sachen Diversität tragen sie definitiv ihren Teil bei: Czyborra kann immerhin eine Dissertation vorweisen, die nicht unter Plagiatsverdacht steht, Günther-Wünsch ist mehrfach tätowiert und Evers schwul – fehlen eigentlich nur noch eine Transperson und jemand im Rollstuhl, um der ganzen Vielfalt Berlins gerecht zu werden.
Ob es aber wirklich die Diversität des Senats ist, die Linken „eine Mahnung“ sein sollte, wie der Tagesspiegel schrieb, oder doch eher die Tatsache, dass Evers noch vor sechs Jahren den Ortsteil Friedrichshain als „Nest von Linksfaschisten“ bezeichnete, das man „ausräuchern“ müsse, mag jeder selbst beurteilen.