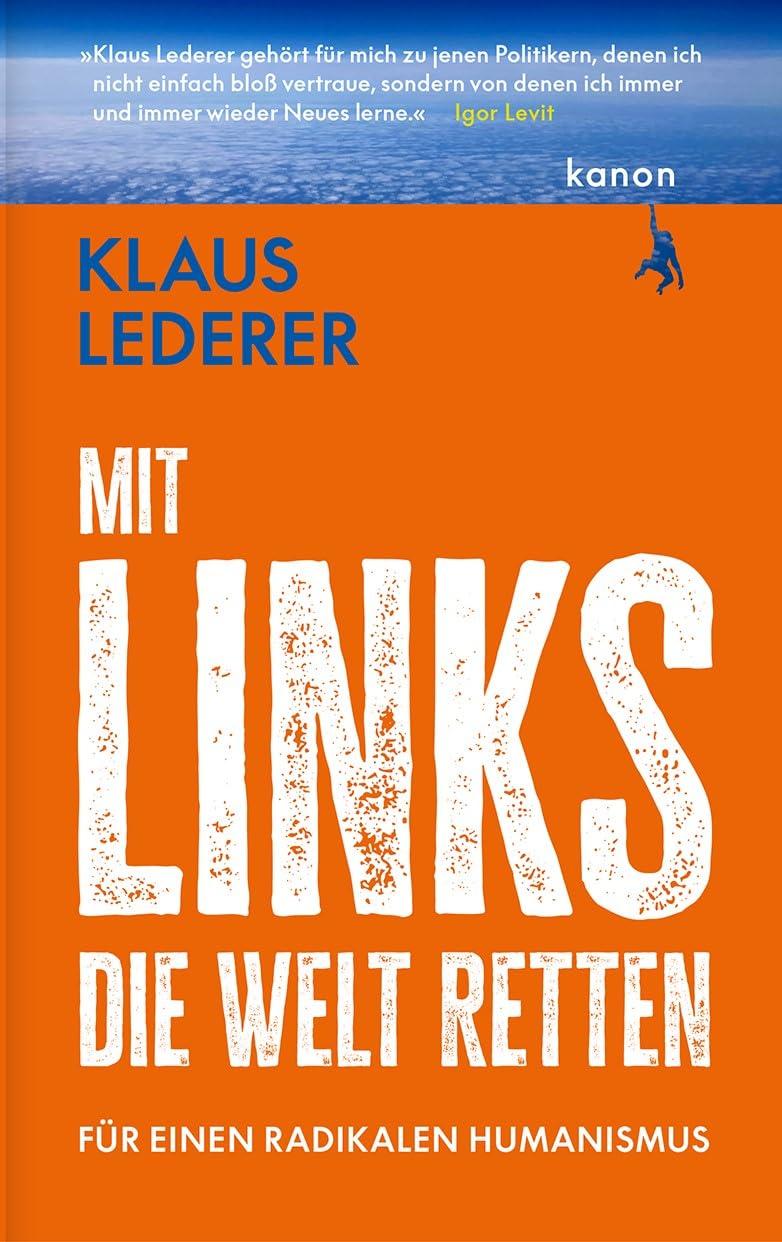Von Markus Liske
(Vollständige Fassung eines in der Jungle World 15/24 gekürzt erschienen Artikels)
Klaus Lederer, ehemaliger Berliner Bürgermeister und Kultursenator von Berlin, hat ein Buch geschrieben, in dem er versucht, seiner Partei Die Linke einen Weg aus drohenden Bedeutungslosigkeit aufzuzeigen. Vielleicht aber wäre es einfach Zeit, Lebewohl zu sagen.
Der Zauber, von dem es heißt, dass er jedem Anfang innewohne, kann sich leicht als Fluch entpuppen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Partei Die Linke. Gerade mal 17 Jahre ist es her, dass sie als Zusammenschluss der vorwiegend in Ostdeutschland relevanten Partei PDS und der weitgehend westdeutsch geprägten WASG entstand. Der Alleinvertretung suggerierende Name, den man sich gab, schien zwar vielen nicht in die Gründung involvierten Linken anmaßend, doch ganz falsch war er nicht. Immerhin hatten in der PDS bereits alte SED-Kader mit punkigen jungen Großstadtlinken zusammengefunden. Mit der WASG kamen nun noch enttäuschte Sozialdemokraten und allerlei ehemalige Aktivisten kruder kommunistischer Kleinstparteien hinzu. Da lag der zauberhafte Gedanke, fortan die komplette deutsche Linke zu vertreten, wohl einfach nahe. Inzwischen allerdings ist unübersehbar geworden, dass genau darin der Fluch lag. Erst gab es eine Austrittswelle, weil es die Partei nicht schaffte, sich von ihrer zunehmend rechtspopulistisch tönenden Talkshow-Gallionsfigur Sahra Wagenknecht zu trennen. Dann zog diese selbst die Reißleine und zahleiche (auch prominente) Parteimitglieder hinüber in ihr neues Querfront-Projekt Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Zurück blieb eine bedröppelte Restpartei, die aber durch die Austritte auch nicht homogener wurde. Denn viele, die eher dem Wagenknecht-Lager zuzuordnen sind, haben den Übertritt in deren neue Partei bislang noch gescheut. Die Erinnerung an das grandiose Scheitern von Wagenknechts „Aufstehen“-Bewegung ist vielleicht noch zu frisch.
Aber auch sonst sind gemeinsame Positionen in der Partei derzeit kaum zu erkennen. Zu nahezu keinem politischen Thema gibt es konsistente Aussagen der Partei. Ihr Grundsatzprogramm stammt von 2011 und bietet keinerlei Antworten auf derzeitige Problemlagen, wie Russlands Krieg in der Ukraine oder Israels Verteidigung gegen die Hamas. Folgerichtig liegt Die Linke in bundesweiten Wahlumfragen inzwischen nur noch bei drei Prozent. In keinem Parlament der westdeutschen Flächenländer ist sie mehr vertreten und selbst bei den kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Sachsen-Anhalt droht sie an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Der Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag und die Notwendigkeit eine neue Führung zu bestimmen hätten eine Neuausrichtung möglich gemacht, aber diese Chance wurde vertan.
„Wer in einer Situation, in der man von Fraktions- auf Gruppengröße zusammengeschmolzen ist, eine Kampfabstimmung durchführt, wo sich eine Fraktionsspitze mit einer stummen Mehrheit durchsetzt, hat den Schuss nicht gehört. Das ist tatsächlich Ausdruck von vollkommener Unfähigkeit, auf die aktuelle Lage zu reagieren.“ So Klaus Lederer, bis vor kurzem noch Kultursenator in Berlin und eines der prominentesten Gesichter der Partei. Bundespolitische Ambitionen hatte der bislang zwar kaum erkennen lassen, versucht nun aber mit seinem frisch erschienenen Buch „Mit links die Welt retten“ (Kanon Verlag) zu skizzieren, wohin sich die Partei seiner Ansicht nach bewegen müsste, um den vollständigen Untergang zu vermeiden.
Lederer ist ein Vertreter jenes großstädtisch geprägten, global denkenden Flügels, den Sahra Wagenknecht gern als „Lifestyle-Linke“ verächtlich macht – queer, kulturaffin, ökologisch und israelsolidarisch. Was er fordert, ist eine konsequente Abkehr von jenem in weiten Teilen der Partei weiterhin virulenten Antiimperialismus, der sich mit Diktatoren und islamofaschistischen Massenmördern gemein macht – hin zu einem demokratischen Sozialismus, der die Freiheit des Individuums, Gleichstellung der Geschlechter und ökologische Verantwortung nicht als bloße Nebenwidersprüche abtut. Das Buch ist ein universalistisches Bekenntnis zu einem „radikalen Humanismus“, wie man es auch unter Grünen oft findet, nur eben mit sozialistischem statt wirtschaftsliberalem Impetus. Für Lederer müssen Klimakrise und soziale Gerechtigkeit als gleichrangige politische Kernthemen der Gegenwart immer zusammengedacht werden: „Ob wir das Ganze dann ‚demokratischen, ökologischen, ethnisch und kulturell diversen Sozialismus‘, ‚partizipativen Sozialismus‘, ‚Neo-Sozialismus‘ oder ‚Degrowth-Kommunismus‘ nennen, finde ich zweitrangig. Wichtiger wäre, die verschiedenen Ideen und Ansätze überhaupt zu einem kohärenten Begriff von Gesellschaft zu verbinden.“
In diesem Versuch verschiedene theoretische Ansätze eher integrieren als auszugrenzen zu wollen, ist er ganz Realpolitiker, der weiß, dass es eine gewisse Breite braucht, um zu einer Zustimmungsrate über fünf Prozent zurückzukommen. Unklar bleibt allerdings, wie das zu realisieren wäre, ohne wieder in alte Flügelkämpfe zu verfallen. Exemplarisch steht hierbei sein Verhältnis zu potentiellen Jungwählern aus dem „postkolonialen“ und „antirassistischen“ Spektrum, die er zwar deutlich für ihren Antisemitismus und das Abfeiern „brutaler Schlächter, Warlords und Diktatoren als ‚antikoloniale Befreiungskämpfer‘“ kritisiert, zugleich aber so tut, als ginge es hierbei nur um eine extremistische Minderheit in einer ansonsten durchaus in seinen „radikalen Humanismus“ integrierbaren Bewegung. Was er dabei übersieht, ist, dass die postkoloniale Theorie unter jungen „Linken“ vermutlich gar nicht diese Relevanz hätte, ginge es nur darum, sich einer historischen Verantwortung zu stellen, ein paar Kunstwerke zurückzugeben und Straßen umzubenennen. Erst mit einem realen und gegenwärtigen Gegner, an dem man sich radikal abarbeiten kann, wird dieses Gedankengebäude attraktiv. Und das sind eben Israel und „der Westen“. Folglich sind Antisemitismus und Diktatorenkuscheln dieser Bewegung fest eingeschrieben.
Auch Lederers Insistieren auf globale Lösungen und internationale Zusammenarbeit klingt zwar gut, blendet aber aus, dass es dafür aktuell kaum ernsthafte Partner gibt. Auch wie eine Unterstützung der Ukraine gegen Wladimir Putins Truppen mit einem Festhalten am grundsätzlichen Antimilitarismus harmonisiert werden könnte, bleibt unklar. Dennoch könnte das Buch ein guter Debattenbeitrag für eine grundsätzliche Reform der Partei sein, sofern diese denn reformierbar wäre. Wahrscheinlicher aber ist, dass sich ihr Gründungsfluch nur mittels Auflösung überwinden lässt. Käme es so, Spott und Schadenfreude wären in Teilen der außerparlamentarischen Linken sicher ähnlich groß wie der reale Schaden, den das erst mal für alle mit sich brächte. Nicht nur, dass etwa antifaschistischen Gruppen in den blau-braunen Provinzen des Landes ein wichtiger Partner verloren ginge, ein Ende der Partei würde zugleich auch das Ende der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihrer organisatorischen und finanziellen Unterstützung für zahllose linke Projekte bedeuten.
Andererseits böte eine Auflösung immerhin die – kleine – Chance, dass sich in Reaktion auf die massiven sozialen Verwerfungen in Folge des Klimawandels, wie sie auch Lederer prognostiziert, und den parallelen Siegeszug rechtsextremer Ideologien eine neue Linke ohne all den antiimperialistischen und antisemitischen Ballast konstituiert – ohne Alleinvertretungsanspruch, dafür mit klarem Profil. Ein aus Versatzstücken verschiedenster ideologischer Verirrungen mühsam zusammengenähtes und zombiefiziert weiterexistierendes Parteikonstrukt würde dem zweifellos eher im Wege stehen.